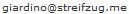... neuere Einträge
Sonntag, 15. Dezember 2013
Hier so

(Fürther Rathaus)
[giardino, 21:18] Permalink (0 Kommentare) 1124
Sonntag, 24. November 2013
Meer
Ich hatte Glück. Seit ich sieben Jahre alt war, fuhren wir fast in jedem Jahr in den großen Ferien an die bretonische Küste. Dort gibt es nicht nur einfach eine Grenze, an der flaches Land endet und eine große Wasserfläche beginnt; das ist eine ganz besondere Küste. Wir machten Urlaub in Cancale, wo das graue Wattenmeer der großen Bucht vom Mont St. Michel an die endlos verästelte, schroffe, braun-schwarze Felsenküste der nördlichen Bretagne stieß. Und auch das Meer war nicht irgendwie nur Wasser, das seenhaft und glatt mit gekräuselten Locken an ein flaches Ufer plätscherte, sondern ein Ausläufer des Atlantiks, der stets golfstromwarm, und oft mit großer Kraft gegen das Land schlug. Von Felsen gesäumte Sandstrände, wunderschön und im Sommer durchaus voller Menschen, aber meist gänzlich ohne Kommerz, von Eintrittsgebühren ganz zu schweigen. Keine kostenpflichtigen Parkplätze, kein Privatbesitz mit Villen, der ganze Strandabschnitte für sich beanspruchen würde.
Das Faszinierendste an dieser Küste sind die Gezeiten. Zur Tag- und Nachtgleiche Mitte September erreicht der Tidenhub 12-13 Meter. 13 Meter! zwischen Flut und Ebbe; alle sechs Stunden steigt und fällt der Wasserspiegel zu dieser Zeit um die Höhe eines vierstöckigen Hauses und verändert die gesamte Landschaft. Einmal steht das Wasser wie eine endlose Fläche vom Horizont bis zu den ersten Häusern und schwappt auf die Küstenstraße, und wenige Stunden später kann man die Brandungslinie kaum mehr erkennen, so weit ist sie weg, in einer Bucht, aus der Schären und Felsen wie Pilze gewachsen zu sein schienen. Und das, wo selbst die Strände recht steil abfallen und man nach wenigen Metern schon keinen Boden unter den Füßen mehr hat – ganz anders als am Mittelmeer, wo oft das unbewegte Wasser nach hundert Metern noch kaum höher als bis zu den Oberschenkeln steht.
Die Ebbe legte Felsenlandschaften frei, in denen ich schon als Kind stundenlang alleine herumkletterte, wobei ich natürliche Becken voll mit Fischen, Muscheln und anderem Kleingetier entdeckte oder kleine Strände nur für mich, nur wenige Meter breit. Grün betangte Steine, Bäche, die aus dem Sand des steil abfallenden Strands quollen und sich zwischen den Steinen nach unten wanden, wo man sie mit Schaufel und Eimer zu Tümpeln stauen konnte; wenn man den richtigen Blick darauf warf, war der Lieblingsstrand meiner Kindheit eine Miniaturlandschaft mit Bergen, Flüssen, Wasserfällen und ganzen Seen.
Ich liebe diese Küste. Natürlich mag ich das Meer auch anderswo. Aber hier ist es für mich am Schönsten. Und erst mit Vierzig, als ich nach vielen Jahren mal wieder an einem Tag mit rauerem Wind ins Wasser ging und nach wenigen Minuten völlig außer Atem wieder herauskam, wurde mir bewusst, wie mutig und fit ich als Junge gewesen sein musste, als ich auch bei höheren Wellen selbstverständlich schwimmen ging (natürlich immer unter Aufsicht meiner Eltern), wenn die Brandung so stark war, dass man in Windeseile zum richtigen Zeitpunkt ins Wassser hinein sowie später wieder heraus kraulen musste, um nicht von den sich brechenden Wellen erwischt und kopfüber über den Boden geschleift zu werden.
Auch wenn ich das aus wachsendemSchiss Respekt vor dieser Naturgewalt nie mehr tun sollte: Wie es sich anfühlt, wenn man die gefährliche Brandungslinie einmal überwunden hat, von der ständigen Wasserbewegung massiert zu werden so dass es einem nicht mehr kalt wird, auf dem Rücken liegend meterweise auf und ab getrieben zu werden, federleicht, abwechselnd alle paar Sekunden nur Wellenberge zu sehen oder aber bis zum Horizont, wenn man auch den Rest des Tages noch das Schaukeln spürt, sobald man die Augen schließt, das werde ich nie vergessen.
[Dieser Beitrag gehört zur »Blogparade Mein Text zum Meer«.]
Das Faszinierendste an dieser Küste sind die Gezeiten. Zur Tag- und Nachtgleiche Mitte September erreicht der Tidenhub 12-13 Meter. 13 Meter! zwischen Flut und Ebbe; alle sechs Stunden steigt und fällt der Wasserspiegel zu dieser Zeit um die Höhe eines vierstöckigen Hauses und verändert die gesamte Landschaft. Einmal steht das Wasser wie eine endlose Fläche vom Horizont bis zu den ersten Häusern und schwappt auf die Küstenstraße, und wenige Stunden später kann man die Brandungslinie kaum mehr erkennen, so weit ist sie weg, in einer Bucht, aus der Schären und Felsen wie Pilze gewachsen zu sein schienen. Und das, wo selbst die Strände recht steil abfallen und man nach wenigen Metern schon keinen Boden unter den Füßen mehr hat – ganz anders als am Mittelmeer, wo oft das unbewegte Wasser nach hundert Metern noch kaum höher als bis zu den Oberschenkeln steht.
Die Ebbe legte Felsenlandschaften frei, in denen ich schon als Kind stundenlang alleine herumkletterte, wobei ich natürliche Becken voll mit Fischen, Muscheln und anderem Kleingetier entdeckte oder kleine Strände nur für mich, nur wenige Meter breit. Grün betangte Steine, Bäche, die aus dem Sand des steil abfallenden Strands quollen und sich zwischen den Steinen nach unten wanden, wo man sie mit Schaufel und Eimer zu Tümpeln stauen konnte; wenn man den richtigen Blick darauf warf, war der Lieblingsstrand meiner Kindheit eine Miniaturlandschaft mit Bergen, Flüssen, Wasserfällen und ganzen Seen.
Ich liebe diese Küste. Natürlich mag ich das Meer auch anderswo. Aber hier ist es für mich am Schönsten. Und erst mit Vierzig, als ich nach vielen Jahren mal wieder an einem Tag mit rauerem Wind ins Wasser ging und nach wenigen Minuten völlig außer Atem wieder herauskam, wurde mir bewusst, wie mutig und fit ich als Junge gewesen sein musste, als ich auch bei höheren Wellen selbstverständlich schwimmen ging (natürlich immer unter Aufsicht meiner Eltern), wenn die Brandung so stark war, dass man in Windeseile zum richtigen Zeitpunkt ins Wassser hinein sowie später wieder heraus kraulen musste, um nicht von den sich brechenden Wellen erwischt und kopfüber über den Boden geschleift zu werden.
Auch wenn ich das aus wachsendem
[Dieser Beitrag gehört zur »Blogparade Mein Text zum Meer«.]
[giardino, 19:15] Permalink (2 Kommentare) 2440
... ältere Einträge